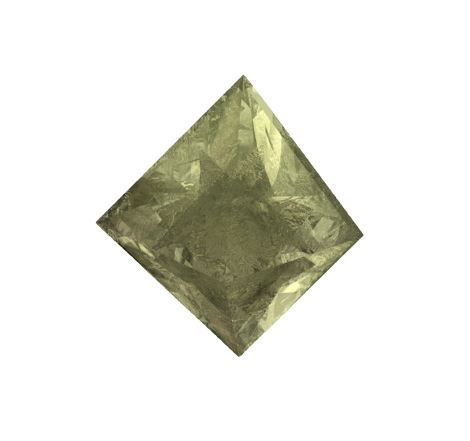In einem visuellen Zeichen verschmelzen für den Rezipienten Signifikant und Signifikat ineinander: Das Bild eines Hauses ist dem wirklichen Haus sehr ähnlich. Ein Haus in einem Film bedeutet nicht einfach als ' Haus ', sondern ist die aktualsierte Rede der vorfilmischen Realität. Ein Umstand, durch den sich der Film von der verbalen Sprache grundlegend unterscheidet, denn deren Stärke besteht ja gerade darin, d a ß es keine Ähnlichkeit zwischen Signifikant und Signifikat gibt. Somit verstärkt sich die Autonomie des Films gegenüber der äußeren Wirklichkeik paradoxerweise, indem er sich dieser Wirklichkeit aufs engste durch die ikonische Analogie annähert.
Analogie und Analogisches Verhältnis (Roland BARTHES)
Im linguistischen Sinn ist die Analogie ein zwischen grammatikalischen Strukturen wahrnehmbares Verhältnis der Gleichartigkeit. Als analogsiche Prägung bezeichnet man die Prägung einer linguistischen Einheit, ausgehend von einer bestehenden Einheit, wobei das neue Verhältnis zwischen den Einheiten das gleiche ist wie dasjenige, welches zwei bereits bestehende Einheiten von der gleichen Natur miteinander verbindet.
Die Analogie erfasst z.B. die Annäherung des Kindes beim Erlernen der Sprache
bzw. einer Konstruktion von Wörtern oder Sätzen, die es nie zuvor gehört hat nach dem Modell von bereits bekannten Sätzen.
Im rhetorischen Sinn ist die Analogie als Verhältnis zwischen gleichartigen Signifikaten oder zwischen Klangbildern die Grundlage einer großen Anzahl von rhetorischen Figuren. Die semantische Analogie erklärt zum Teil die Tropen, die klangliche Analogie, die Figuren wie Reim, Assoziation, Alliteration etc.
In der deutschen Sprachwissenschaft ist die Analogie auch der Ausdruck Bedeutungsangleichung oder Bedeutungsumwandlung gebräuchlich.