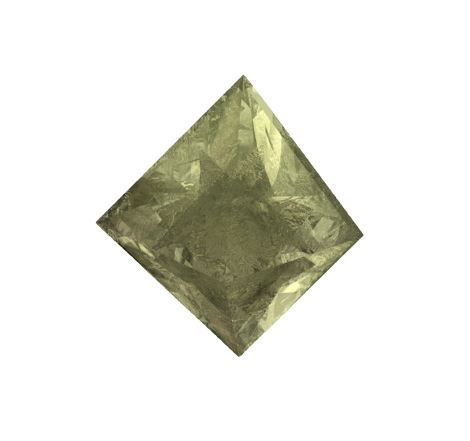Dynamik lässt sich nur dann umsetzten, wenn die Kamera selber in Bewegung gerät, indem der Kameramann sich dem Objekt von allen nur erdenklichen Positionen nähert. Das ' Kinoglaz ' ist bei VERTOV nicht nur eine Absage an die bloße Reproduktion der Realität, es ist die Forderung an die Kamera, das Auge des Zuschauers durch Raum und Zeit zu führen.
" Wir bekräftigen die Zukunft der Filmkunst durch die Ablehnung ihrer Gegenwart.
Der Tod des Kinematographen ist notwendig für das Leben der Filmkunst. Wir rufen dazu auf, seinen Tod zu beschleunigen. Wir protestieren gegen die Ineinanderschiebung der Künste, die viele eine Synthese nennen.....Wir säubern die Filmsache von allem, was sich einschleicht, von der Musik, der Literatur und dem Theater; wir suchen ihren nirgendwo gestohlenen Rhythmus und finden ihn in den Bewegungen der Dinge. " ( ALBERSMEIER.Texte zur Theorie des Films. Stuttgart: Reclam, 1979, Seite 32)
VERTOV lehnt die mit Schauspielern erzählten und inszenierten Filme aus ideologischenr Sicht des Kommunismus der UDSSR ab. Diese Art von Filmen wren ihm einfach zu bürgerlich. Als Sowjetbürger glaubt er an die Revolution und die Macht durch technologischen Fortschritt. Die Mechanik der Kamera, diese neuartige Maschine revolutioniert unsere Sicht der Welt und somit der Gesellschaft. Das Kino-Auge, die Kameralinse, sieht die Welt objektiv so wie sie ist. Das Bürgertum jedoch bevorzugt das verlogene Spiel mit inszenierten Welten, die sich ihre Legitimation durch andere Künste unfilmisch erst erwerben müssen.
Filmografie in Auswahl
Kinoglaz//Kino-Auge (1924)
In seinem Film "Der Mann mit der Kamera" (1929, 68 Minuten lang, Stummfilm
S/W) dokumentiert er den Tagesablau einer Großstadt in der UDSSR.
Ein Sechstel der Erde (1926)
Das elfte Jahr (1928)
Der Mann mit der Kamera (1929)
Die Donbaß-Sinfonie (1930)
Drei Lieder über Lenin (1931)
Wiegenlied (1937)
Drei Heldinnen (1938)