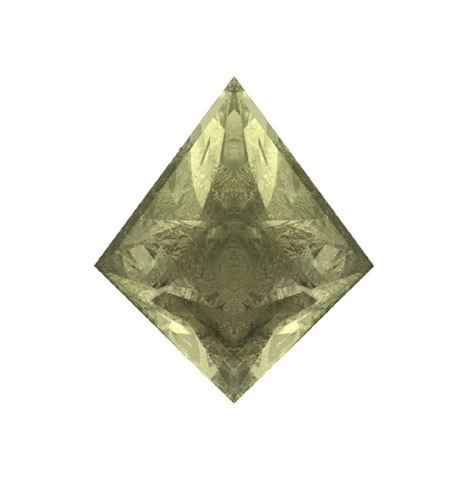Wird die Funktionalität allgemein bezogen auf die jeweilige Gesellschaft, so fehlt ihr in dieser Betrachtungsweise der für jede Funktionsuntersuchung notwendige genau angebbare Bezugspunkt. Die Funktion als solche kann darum auch gar nicht untersucht werden. Die Funktionalität des Systems wird axiomatisch vorausgesetzt. Erkenntnistheoretisch ist der Begriff der Funktionalität damit ein blinder Fleck im sehenden Auge der Theorie. Als weiterer Kritikpunkt bleibt auch die Frage nach Ursache und Wirkung eines so als funktional definierten Schichtungssystems offen. Durch die Betonung der Belohnung, die an eine gesellschaftliche Position fest gebunden ist, anstelle des Sozialprestiges, für das der jeweilige Positionsinhaber durch die spezifische Ausprägung seiner Rolle zusätzliche Bestimmungsgründe liefert, also nur in seiner groben Ausprägung an die Position fest gebunden sit, wird die individuelle Komponente zu Unrecht ausgeklammert. Die gesamte Schichtungstheorie orientiert sich zusehr an einem Berufssystem. Wird die Belohnung als funktional notwendiges Anreizmoment für potentielle Positionsinhaber bezeichnet, so heißt das zugleich, daß ohne einen solchen Anreiz kaum jemand die für die wichtige Rollen innerhalb einer Gesellschaft und ihrer Subsysteme und (Kontoll,- Steuerungs-) Instanzen kam irgendjemand die für die wichtige Rollen notwendigen Entbehrungen und Bemühungen auf sich nehmen würde. Dies aber stellt eine empirisch wohl kaum verifizierbare These dar, weil sie alle übrigen sozialen wie auch die psychischen Anreizmöglichkeiten außer aucht lässt. Das am ökonomischen Marktmodell orientierte Knappheitsprinzip der Talente für hohere Positionen dürfte nur nachprüfbar sein, wenn ein völlig freier Wettbewerb solcher Talente stattfinden könnte. In der BRD und dem späteren wiedervereinigten Deutschland, wo gilt Zukunft gleich Herkunft, findet ein solch geforderter, ersehnter freier Wettbewerb der Fähigkeiten aller Individuen bestimmt nicht statt. Durch die Positionszuweisungsmechanismen und die Einschränkung der Möglichkeiten der Erlangung von Ausbildungsplätzen (Schule, Lehre, Studium etc.) und der Teilnahme an Bildung wird ein solch freier Wettbewerb reguliert. Jeder, der aus dem richtigen Elternhaus kommt (bildungsnah) findet seinen Weg zum Abitur und sei es am Ende ein Internat. Und jeder, der aus bildungsfernenen Schichten stammt wird unter irgendeinem Vorwand durch die Selektionsmechanismen von diesen Möglichkeiten an Entfaltung ausgeschlossen. Für diesen Personenkreis bleiben in Deutschland lediglich die Auffangprogramme großzügig übrig. Man stellt zuerst jemanden ein Bein und wenn er dann fällt hilft man ihm großzügig auf. Die Selektion erfolgt also vorbeugend, damit wird die oben dargestellte These weitgehend hinfällig. Mit größerer Berechtigung könnte man von einer Knappheit der Positionen mit höchst qualifizierten Rollenanforderungen sprechen und von daher einzelne Selektionsmechanismen - soweit sie rational aus dem Systemzusammenhang und seiner Offenheit für sozialen Wandel heraus legitimiert werden können - als funktional zu erklären versuchen.