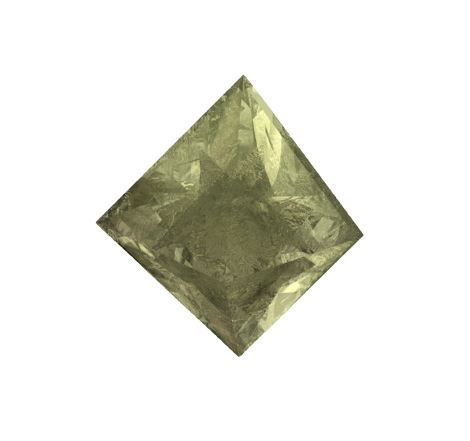In der Ideenlehre PLATONs (427 bis 347 v. Chr.) wird die Auffassung vertreten, daß die Welt hierarchisch gegliedert sei in konkrete Einzeldinge und ewigen Ideen. Die sinnlichen Erscheinungen, der uns umgebenden Wirklichkeit, sind nicht autonom. Sie nehmen graduell an den Ideen teil, die als Ur-Bilder aller individuellen Erscheinungen erst die eigentliche Wirlichkeit bilden. Die Ideen verursachen die unbeständigen Einzeldinge in ihrem Sein und sind selber unveränderlich und zeitlos. Bei PLATON wird die höchste Idee - die Kalogathie (Schöngutheit) - als Demiurg (Weltbildner) aufgefasst. Wenn die Ideen eine höhere Wirklichkeit sind, so können die Erscheinungen der sinnlich erfahrbaren Welt in ihrer Zufälligkeit nur noch schein sein. Im Höhlengleichnis vertritt PLATON sogar die Auffassung, daß sie einen Hindernisgrund für die Erkenntnis der Wirklichkeit überhaupt bilden. Wie im Buddhismus ist die äußere Welt bloßer Schein (Maya), der uns um die Wahrheit betrügt.
Die Begriffe der Sprache besitzen die gleichen Eigenschaften wie die Objekte selber auf die sie sich beziehen. Insofern ist die Sprache ein Abbild der Welt, im Sinne zumindest einer graduellen Idenität. Die Begriffsbildung geht nach PLATON auf die Wiederinnnerung der menschlichen Seele an die Ideen zurück. So ist es uns möglich, in bestimmten Begriffen die ewigen Ideen zu erkennen. Den zufälligen Einzelerscheinungen werden die Individualbegriffe zugeordnet, den ewigen Ideen die Gattungsbegriffe. Die unterste Ebene einer solchen Ordnung bilden die Individualbegriffe. Das Wort "blau" bezeichnet in dem Satz "Der Stuhl ist blau" eine einmalige Erscheinung der Farbe Blau. Alle anderen Erscheinungen der äußeren Welt, die ebenso wie der Stuhl, eine individuelle Farbnuance der Farbe Blau besitzen, haben diese nur aus dem Grund, weil es eine Idee (ihr Wesen) der Farbe Blau gibt (Blauheit), die allen nur möglichen Nuancen notwendig gemeinsam ist und diese verursacht. Wenn die Gattungsbegriffe derart an den Ideen teilhaben, dann impliziert dies die Identität von Sprache und Wirklichkeit, von Subjekt und Objekt. Es ist möglich, in der Sprache das Wesen der Welt zu erkennen. Die Ideenlehre PLATONs stellt somit eine Abwertung der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit dar. Die konkreten Erscheinungen der Außenwelt sind unwirklicher, als die außerhalb jeder