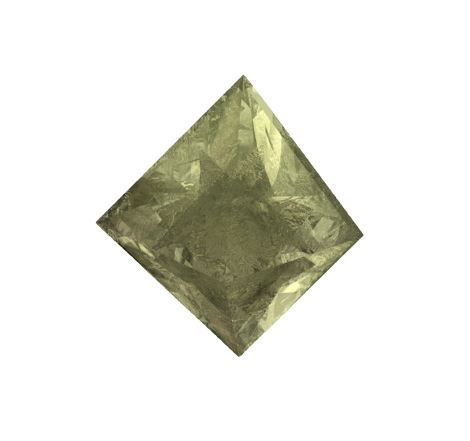sinnlichen Erfahrung existierenden Ideen. eine solche Entwertung der empirischen Wirklichkeit blieb schon in der Antike nicht ohne Widerspruch. die Kyniker und Stoiker kritisierten heftig die platonische Ideenlehre. Eine Kritik, die ihre Parallele im Universalienstreit des Mittelalters hat.
ARISTOTELES (384-322 v.Chr.) versetzt in seiner Philosophie die Ideen in die empirische Welt hinein, verändert jedoch dadurch keineswegs die Grundüberlegungen der platonischen Ideenlehre. In seiner Poetik stellt ARISTOTELES die Frage nach der Beziehung zwischen dem Kunstwerk und der Wirklichkeit. Der zentrale Begriff für diese Problematik ist die Mimesis. Sie stammt nicht ursprünglich von ARISTOTELES, sondern geht auf PLATON zurück. In seinem Hauptwerk Der Staat behandelt PLATON auch die Künste. Es ist also nur allzu konsequent, wenn er in Anlehnung an seine Ideenlehre die bloße Nachahmung der Wirklichkeit durch die Kunst ablehnt. Da die Ideen sich nur sehr unvollkommen in der Schattenwelt der sinnlichen Erscheinungen zeigen, wird der Künstler der Wahrheit um so näher kommen, je mehr er von der Abbildung abweicht. ARISTOTELES knüpft an diese Überlegung an. Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Übersetzung der Mimesis bei ARISTOTELES mit "Nachahmung" zu einschränkend ist. Sie geht auf das lateinische "imitatio" zurück. Die erweiterte Bedeutung der Mimesis bewegt sich zwei extremen Positionen: Die eine umfasst die Forderung nach einer möglichst getreuen Abbildung von zuvor empirisch versicherten Objekten (das Dokumentarische). Die andere umfasst die Forderung nach der Darstellung, in der sich das mögliche durch die stilisierende Einbildungskraft entfaltet (das Fiktive). Beide Auslegungen stellt ARISTOTELES im Geschichtsschreiber und im Poeten einander gegenüber.
Für ihn ist der Poet wahrer als der Geschichtsschreiber, da dieser sich nicht auf das Allgemeine bezieht, sondern in seiner Dokumentation nur das Zufällige und unbeständige als Grundlage nimmt.