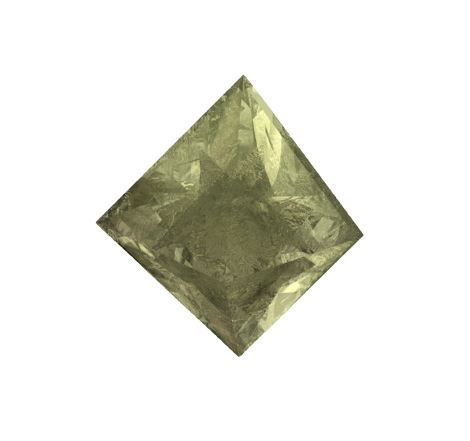
Welt sowie ihrer aggressiven Vereinnahmung durch Natrurwissenschaft und Technik ungeeignet, blieben nur noch die illustrierenden Darstellungen biblischer Szenen (RAFFAEL, MICHELANGELO, da VINCI) oder die Portraits der Oberschicht (REMBRANDT). Außer der einer Hilfsfunktion schien das Bild ungeeignet zu sein. Als Illustration, um einen Sachverhalt ergänzend zum Text zu erläutern, nie aber alleine ohne gedrucktes Wort. Die visuelle Sprache schien zu primitiv zu sein, um die Forderungen einer immer komplexeren Entwicklung zur Rationalität und Naturbeherrschung in der westlichen Kultur nachzukommen. Zwei Ereignisse in der Entwicklung der Kommunikation und ihren Medien veränderte die Stellung der visuellen Sprache gegenüber dem gedruckten Wort.
Um 1400 begann in Flandern und Italien der Bruch der Kunst mit der bis dahin gültigen Vorstellung von Körper und Raum. Maler wie MASACCIO oder Jan van EYCK bildeten den Menschen und die Natur perspektivisch ab. In dem aufkeimenden Humanismus - jene individualistische und anthropozentrische Anschauung - wandten sich die Künstler der physischen Welt in einem Ausmaß zu, wie es vorher für die Malerei niemals möglich gewesen war. Die Bemühungen und Fortschritte um die Zentralperspektive in der Abbildung von Raum und Körper, wie sie charakteristisch ist für die naturalistische Darstellungsweise der Renaissance, war der in der Art der Darstellung mittelalterlicher Ikonen völlig fremd. In der Ikonenmalerei dargestellte Szenen spielten sich in ihrer religiösen Symbolik außerhalb des wirklichen Raumes fern von jeder Natur ab. Der Hintergrund der Ikonenmalerei war golden, als gäbe es das Blau des sichtbaren Himmels nicht. Figuren wurden nicht körperhaft gemalt, denn sie waren nichts sinnlich Erfahrbares. Eindeutig festgelegt wurden die religiösen Themen durch die Glaubensinhalte der christlichen Kirche, welche das Individuum und die physische Natur am äußersten Ende einer ontologischen und moralischen Hierarchie sah.










